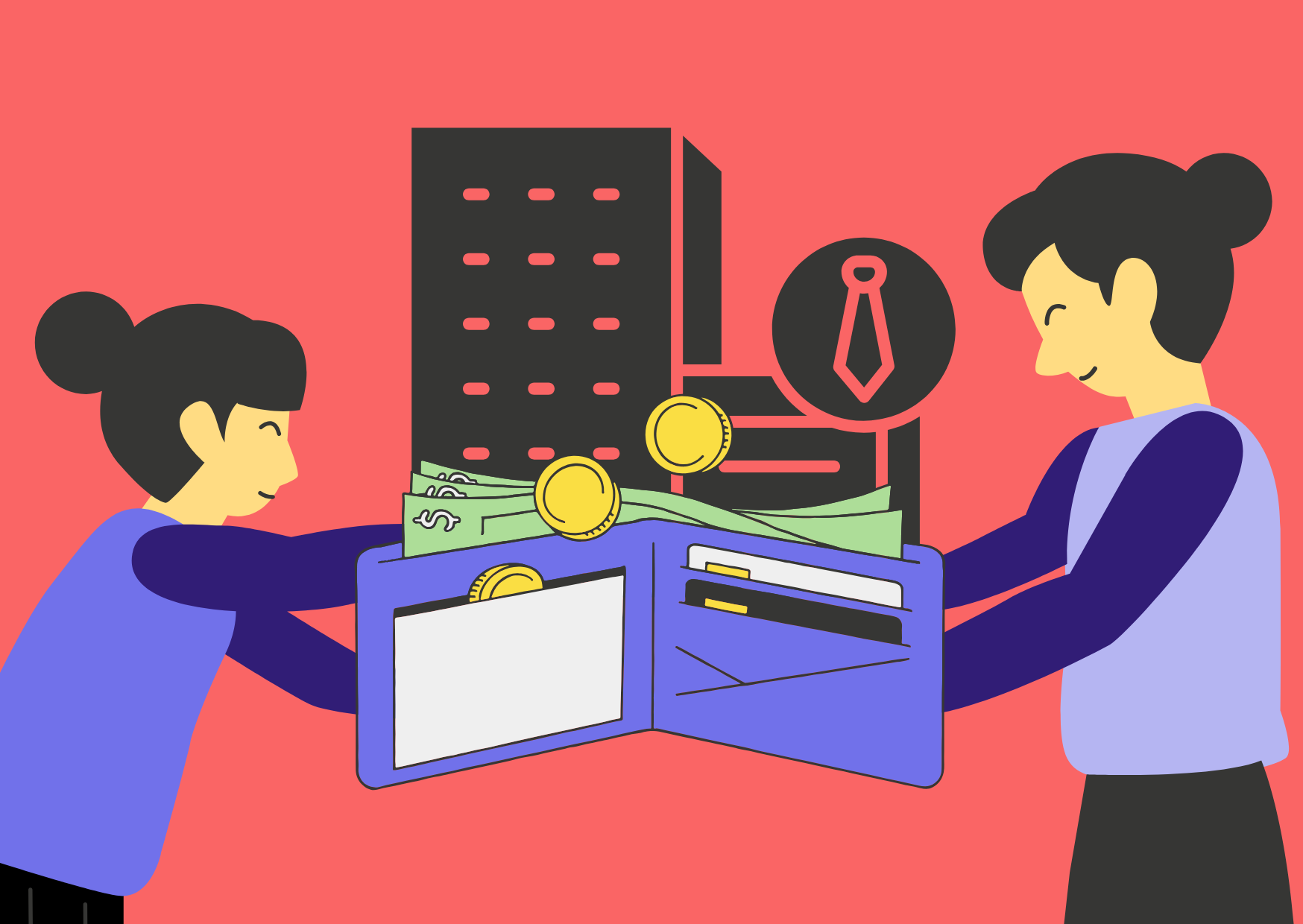Viele Unternehmer überlegen, ob sie sich Gewinne jedes Jahr ausschütten oder lieber in der Gesellschaft belassen sollen. Steuerlich kann es sich lohnen, Gewinne im Unternehmen zu behalten, anstatt sie laufend auszuschütten und darauf Einkommenssteuern zu bezahlen. Verkauft man später die Anteile an der Gesellschaft, erzielt man einen steuerfreien Kapitalgewinn – und verkauft damit im besten Fall «das volle Portemonnaie» mitsamt den thesaurierten Gewinnen, weil der Verkaufserlös entsprechend höher ist. Genau hier kommt allerdings die indirekte Teilliquidation ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass dieser steuerfreie Kapitalgewinn nachträglich möglicherweise zu steuerbarem Einkommen qualifiziert wird. Wer aber die Spielregeln kennt, kann dies verhindern und den Vorteil nutzen – muss aber auch darauf achten, dass der Käufer nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre die Kasse der Gesellschaft plündert.
Die relevanten Rechtsgrundlagen und Tatbestandselemente
Der Tatbestand der indirekten Teilliquidation ist im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) in Art. 20a Abs. 1 lit. a geregelt. Aus der Norm lassen sich die einzelnen Tatbestandelemente herausschälen, die erfüllt sein müssen, damit eine indirekte Teilliquidation vorliegt.
Zur Veranschaulichung dieser Tatbestandselemente bzw. von Anwendungsfällen dient auch das Kreisschreiben Nr. 14 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Die Kreisschreiben der ESTV sind Verwaltungsweisungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, welche die Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen konkretisieren und vereinheitlichen; sie binden zwar primär die Steuerbehörden, haben in der Praxis aber grosse Bedeutung für die Rechtssicherheit von Steuerpflichtigen und Beratern, dienen als Orientierung bei der Rechtsanwendung und sind öffentlich abrufbar auf der Website der ESTV.
Die Voraussetzungen in der Übersicht:
- Entgeltlicher Verkauf
Gemeint ist ein normaler Verkauf der Unternehmensanteile gegen Geld oder auch ein Tausch.
- 20 %-Schwelle
Erst wenn mindestens 20 % des Unternehmens den Besitzer wechseln, greift die Norm. Diese Schwelle kann man auch durch mehrere Verkäufe innerhalb von fünf Jahren erreichen – oder wenn mehrere Verkäufer sich zusammentun.
- Systemwechsel
Die indirekte Teilliquidation setzt voraus, dass eine natürliche Person Beteiligungsrechte aus ihrem Privatvermögen verkauft und die Beteiligung beim Käufer im Geschäftsvermögen landet – sei es bei einer natürlichen Person als Käufer im Geschäftsvermögen (inkl. gewillkürtem Geschäftsvermögen) oder bei einer juristischen Person (dort stets Geschäftsvermögen). Genau dieser Systemwechsel ist relevant.
- Fünfjahresfrist
Das Gesetz schaut fünf Jahre nach dem Verkauf ganz genau hin. Substanzausschüttungen in diesem Zeitraum sind heikel. Jeder neue Verkaufsvorgang setzt dabei seine eigene Fünfjahresfrist in Gang.
- Substanzentnahmen
Dazu gehören nicht nur Dividenden, sondern auch verdeckte Ausschüttungen und geldwerte Vorteile – etwa Darlehen oder Sicherheiten der Zielgesellschaft zugunsten der Käuferfinanzierung. Wichtig ist immer: fliessen Mittel aus der Gesellschaft ab, um den Kaufpreis oder dessen Finanzierung zu stemmen?
- Ausschüttungsfähige, nicht betriebsnotwendige Mittel
Relevant ist nur, was im Verkaufszeitpunkt bereits ausschüttbar war und für den Betrieb nicht benötigt ist. Gewinne, die erst nach dem Verkauf entstehen, sind unproblematisch. Ob Vermögenswerte betriebsnotwendig sind, hängt von der wirtschaftlichen Funktion ab und wird im Einzelfall beurteilt.
- Mitwirkung des Verkäufers
Der Verkäufer muss irgendwie mitwirken – aktiv, indem er Darlehen gibt oder Sicherheiten zulässt, oder indem er andere Massnahmen ermöglicht, die eine spätere Kaufpreisfinanzierung aus der Gesellschaft erlauben. Passiv, wenn erkennbar ist, dass die Finanzierung des Kaufs ohne Ausschüttungen aus dem Unternehmen nicht funktioniert. Entscheidend ist nicht nur tatsächliches Wissen, sondern auch, ob die Finanzierungslage erkennbar war.
Rechtsfolgen – was passiert bei einer indirekten Teilliquidation?
Ist der Tatbestand der indirekten Teilliquidation erfüllt, verliert der Verkäufer einen wichtigen Vorteil: der eigentlich steuerfreie Kapitalgewinn wird teilweise in steuerbares Einkommen umqualifiziert. Praktisch heisst das:
- Besteuerung als Einkommen
Der betroffene Teil des Verkaufserlöses wird als Vermögensertrag versteuert.
- Bemessung nach dem «kleinsten Betrag»
Steuerbar ist nur der kleinste Wert aus: (i) Verkaufserlös, (ii) ausgeschütteter Betrag, (iii) im Verkaufszeitpunkt vorhandene Reserven und (iv) nicht betriebsnotwendige Mittel – jeweils anteilig entsprechend der verkauften Beteiligung.
- Folgen für Käufer und Gesellschaft
Die steuerlichen Konsequenzen treffen primär den Verkäufer. Für Käufer und Zielgesellschaft gelten die allgemeinen Regeln (z. B. Dividendenbesteuerung, Verrechnungssteuer), ohne dass es eine spezielle zusätzliche Belastung wegen der indirekten Teilliquidation gibt.
Handlungsbedarf – worauf auf Verkäuferseite zu achten ist
Für Unternehmer, die ihre Nachfolge regeln oder einen Verkauf planen, ist die indirekte Teilliquidation ein Thema mit zwei Gesichtern: eine steuerliche Chance, wenn man Gewinne im Unternehmen belässt, und ein Risiko, wenn nach dem Verkauf durch den Käufer Substanz entnommen wird. In der Praxis empfiehlt sich ein mehrstufiger Ansatz:
- Frühe Analyse der Finanzierung
Schon vor dem Verkauf sollte man prüfen, wie der Käufer den Preis finanziert. Reine Fremdfinanzierungen, die ohne spätere Ausschüttungen nicht tragfähig sind, bergen besonderes Risiko.
- Vertragsgestaltung als Schutzschild
Im Kaufvertrag können Regeln helfen: Dividendensperren, Einschränkungen bei Darlehen oder Sicherheiten sowie Reporting-Pflichten. Zusätzlich können Freistellungsklauseln, Garantien oder Kaufpreisanpassungen (z. B. via Escrow oder Indemnität) vereinbart werden, um den Verkäufer im Fall einer späteren Besteuerung abzusichern.
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
Eine saubere Dokumentation von Finanzierung, Mittelverwendung und Geschäftsentwicklung schafft Beweissicherheit – besonders für die Abgrenzung zwischen «alter Substanz» und neuen Gewinnen.
Fazit
Die indirekte Teilliquidation ist nicht nur ein Risiko, sondern auch eine echte Gestaltungschance. Statt sich Gewinne laufend steuerpflichtig auszahlen zu lassen, kannst du sie im Unternehmen belassen und später steuerfrei mitverkaufen und vom höheren Erlös auf deinen Anteilen profitieren – das «volle Portemonnaie». Damit dieser Vorteil nicht verloren geht, müssen die Spielregeln beachtet werden: Insbesondere die Fünfjahresfrist und der Umgang mit Substanzentnahmen sind relevant.
Wer sich frühzeitig beraten lässt und insbesondere vertraglich absichert, kann nicht nur das Risiko kontrollieren, sondern vor allem eines: den steuerlich optimalen Exit sichern.